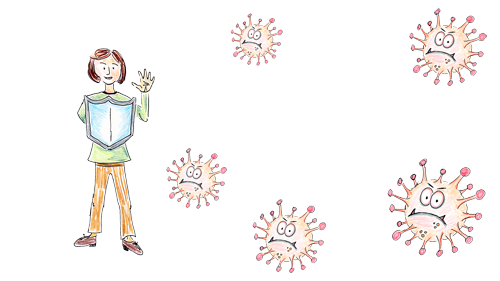 Liebe ZAK-Teilnehmer*innen, Freund*innen und Interessierte,
Liebe ZAK-Teilnehmer*innen, Freund*innen und Interessierte,
viele schlimme Nachrichten begleiten uns in den letzten Wochen. Menschen aus Gütersloh fühlen sich stigmatisiert, Bewohner*innen anderer Coronarisikogebiete erleben Diskriminierung. Der lang ersehnte Traumurlaub nur unter Bedingungen, die eher Stress als Erholung bedeuten. Für manche Reisen muß man nachweisen, dass man gesund ist. Viele Arbeitnehmer*innen, für die sich in letzter Zeit ständig alles verändert hat, fühlen sich wie kurz vor dem Burn-Out. Andere wiederum leiden an einem Bore-Out, weil ihnen jede sinnvolle Beschäftigung fehlt. Die Gefahr herausfordernden Verhaltens steigt deutlich im Alltag. Viele sind genervt von den „neuen“ Barrieren im Alltag, leiden unter sozialer Isolation und verdienen weniger Geld. Und wir alle putzen zwanghaft Türlklinken.
Während für viele Menschen dieses Covid-19-Erleben ein temporäres ist, liest sich der Text für andere eher ironisch:
Stigmatisierung, Diskriminierung, ein Ausschluss aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, abhängig zu sein von Entscheidungen anderer, Barrieren beim Einkauf, soziale Isolation, leben am Existenminimum – für einige Menschen ist das der ganz normale Alltag.
Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, über Inklusion zu sprechen ..?
Wie stellen wir uns eine Gesellschaft vor, in der alle zusammen gut leben können? Welche Lebenräume soll sie bieten können, und was bedeutet eigentlich „Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“?
 Wer ist die Gemeinschaft – ist das die Mehrheit? Darf man sich auch entscheiden, in einer eigenen, kleinen Gemeinschaft abseits der Mehrheit zu leben?
Wer ist die Gemeinschaft – ist das die Mehrheit? Darf man sich auch entscheiden, in einer eigenen, kleinen Gemeinschaft abseits der Mehrheit zu leben?
Ist es „Exklusion“, wenn Menschen mit Autismus sich für eigene Räume entscheiden? Wenn ein Ort einen besonderen Rahmen bietet für Kinder mit speziellen Bedürfnissen, oder eine Schule sich für eine Klasse entscheidet, in der das Unterrichtsformat speziell auf Kinder mit Autismus ausgerichtet ist?
Brauchen wir wirklich eine Schule für Alle oder brauchen wir viele unterschiedliche Schulen, um Kinder möglichst individuell begleiten zu können? Was wünschen wir uns eigentlich von „Schule“? Was bedeutet „sinnvolle Beschäftigung“, und was gibt dieser Beschäftigung Sinn – und wer definiert ihn?
Seit vielen Jahren beschäftigen uns diese Fragen, keine davon ist wirklich neu. Neu ist, dass wir nun alle irgendwie „Betroffen“ sind. Und nach Antworten suchen.
Uns interessieren Ihre Antworten. Vielleicht haben Sie Ideen, vielleicht haben Sie Lösungen gefunden, vielleicht haben Sie spontane Gedanken zu diesem Text, die sie mit uns teilen möchten.
Auf dieser Seite sammlen wir Ihre Zuschriften (auf Wunsch anonymisiert). info@zak-hannover.de
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften – von einem kurzen Kommentar bis hin zu einer längeren Ausarbeitung;-)
Ich finde „Inklusion“ bedeutet nicht zwingenderweise, dass jemand teilhaben MUSS.
Vielmehr sollte es die freie, eigene Entscheidung jedes Einzelnen sein dürfen, wie er leben möchte,
was er tun möchte, welche Kontakte er pflegen möchte, … und dass diese Entscheidung von seinem Umfeld akzeptiert wird.Für mich ist INKLUSION also tolerierte Selbstbestimmung.
Melanie K., Ausbilderin Büro B.B.W. Abensberg
Teilhabe bedeutet das man frei entscheiden kann wie Lernen gut gelingen kann. Wir sehen immer wieder große Probleme sowohl in den Regelschulen wie auch an den Sonderschulen! Warum kann eine Schule nicht sagen – klar wir nehmen Autisten auf mit einer Fachlichen Schulbegleitung, weil diese viel mehr Wissen hat um individuelle Wege gehen zu können, denn wir wünschen uns ja das dieses autistische Kind eine gute Schulzeit erfahren kann. (Fachliche Schulbegleiter haben einen anderen rechtlichen Stand) Alleine das Thema Auszeitraum! Viele Schulen sind nicht bereit dazu. Oder das die Schulbegleitung mit dem Kind das Gelände verlassen darf, ist oft ein Problem und das sind Kleinigkeiten. Thema Pausen: es sollte frei und offen gesagt werden können, ob man in den Hof möchte. Eine Menge autistischer Kinder hat damit große Probleme und kann die Pause dann nämlich nicht nutzen so wie es vorgesehen ist, weil diese noch mehr Stress verursacht ! Doch es gibt Schulen da heißt es „Pausen müssen im Hof stattfinden, das ist Teilhabe“ ! Nein, liebe Schulen für autistische Kinder oft nicht.
Wenn ein Schüler mit der Klasse Probleme hat, dann kann er auch alleine lernen mit seiner SB. Wenn ein Schüler den Schulalltag nicht mehr schafft, finden wir einen Weg. Ob er dann kürzer kommt, weniger, online beschult wird oder zu Hause unterrichtet wird, besprechen wir, wenn es gebraucht wird.
Es sollte schnell und unkompliziert umzusetzen sein. So könnten viele autistische Kinder gesund und mit Abschluss durch die Schulzeit kommen!
Konstanze vom Verein Selbstbestimmt Autistisch 2019 e.V.
Inklusion ist insbesondere im Kontext von Schule ein Thema, dass mich sehr begleitet. Ich arbeite seit ein paar Jahren als Schulbegleiterin mit Kindern im Autismusspektrum und seit Kurzem als Autismusambulanzfachkraft (was auch immer das heiße mag) und habe selbst Kinder, die nun ins schulpflichtige Alter kommen. Inklusion bedeutet für mich, dass jeder und jede und diverse sowieso, seinen eigenen Platz in dieser Welt hat und diesen auch selbstbestimmt auswählen darf, soweit ihm oder ihr dies möglich ist.
Ich erlebe im Moment, dass Inklusion in der Schule bedeutet, dass es „Schulen für alle“ geben MUSS, unabhängig davon, ob der Schüler oder die Schülerin dafür geeignet ist. Klassengrößen an Regelschulen liegen in der Regel zwischen 20 und 27 Schülern. Schüler mit Inklusionsplätzen reduzieren die Klassengröße insgesamt, wobei gerade für Schüler mit einer veränderten Wahrnehmung auch Klassen mit 15 Schülern noch zu groß sind. Förderschulen werden abgebaut, weil diese „Exklusiv“ sind und ich hoffe sehr, dass wir rechtzeitig die Kurve bekommen, bevor wir nach den Schulen für Lernhilfe auch noch die Schulen für Geistige Entwicklung abschaffen und die unzähligen anderen Schulen, die auf besondere Bedürfnisse ihrer Schüler eingehen. Vorab müssen wir schauen, worauf Schule eigentlich ausgerichtet ist. Zurzeit ist es wohl so, dass die meisten Schulen, auch wenn sie anderes von sich behaupten, darauf ausgerichtet sind, Schüler und Schülerinnen dem „System“, dem 1. Arbeitsmarkt anzupassen und zu unterwerfen, wobei auch dieses zunehmend schlechter gelingt, wer nicht auf den ersten Arbeitsmarkt passt, wird eben nicht darin unterstützt Teil dessen zu werden, sondern so schnell wie Möglich ganz raus gekickt, alles andere wäre eben doch zu teuer.
Ziel von Bildung sollte es nach meinem persönlichen Verständnis sein, einem Menschen Wege zu vermitteln, nach seinen Möglichkeiten die beste Version seiner selbst zu werden, die alle individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Energieressourcen berücksichtigt. Für mich gehört dazu nicht bestehende Schulen abzuschaffen, sondern genau zu schauen, für welches Kind welche Schule gut sein kann und auch, ob nicht vielleicht für die kleine stille Regelschülerin aus der letzten Bank, die ständig mit dem Bleistift auf dem Tisch herum trommelt, ein Platz an einer Förderschule mit einer individuellen Betreuung, die ihren Bedürfnissen entspricht doch das Abi erreichen kann. An dieser Stelle könnte ich nun einen Roman zum Thema Prüfungen, Abschlussprüfungen und Leistungsnachweise schreiben, doch das sprengt hier den Rahmen. Nicht nur Sonderpädagogen an Regelschulen, sondern auch Sek. II Pädagogen an Förderschulen. Wobei sich auch hier die Frage stellt, ob wir nicht die Ausbildung unserer Pädagogen gänzlich umstellen müssen um wirklich inklusiv arbeiten zu können, denn von nichts ist ein Erstklässler abhängiger, als von der inneren Haltung der Klassenlehrerin.
„Corona“ setzt uns auch hier die Lupe auf und es lohnt sich ganz ganz ganz genau hinzuschauen, was mit Schule in dieser Zeit passiert. In den allgemeinen Medien, für mich die Tageszeitung und der Inforadiosender meines Vertrauens, nehme ich überwiegend den Ruf nach einer Rückkehr in die Schule und einen Digitalisierungsdruck wahr. Digitalisierung? Ja! Da hängen wir tatsächlich hinterher, doch auch hier müssen wir genau hinschauen, wer setzt das in den Schulen um? Sind die Lehrer und Lehrerinnen darauf vorbereitet und können sie die Konzepte überhaupt umsetzen? Zurück in die Schule? Wirklich? Für Alle? Ich begleite eine Schülerin, die zuhause deutlich besser lernt, so gut und so schnell, dass ich die Klassenlehrerin zwischenzeitig anbetteln musste, mir neue Materialien zur Verfügung zu stellen und sehr sehr sehr viel selbst gebastelt und erdacht habe. Doch auch hier die Frage, ist es, wenn das Kind daheim gut lernt, eine gute Lösung für alle beteiligten? Darf Mama dann nicht mehr arbeiten gehen, weil eins der Kinder daheim beschult wird und die Schulbegleiterin, die diese Aufgabe übernimmt, nicht die Aufsichtspflicht hat? Sind Schulbegleiter und Schulbegleiterinnen überhaupt dafür ausgebildet Aufgaben in dieser Form zu übernehmen? Und gehen vielleicht nicht doch eine Reihe an Lernimpulsen verloren, wenn SchülerInnen immer daheim beschult werden oder ist eine verkürzte Schulwoche nicht auch eine Option? Inklusion kann nicht für Gruppen von Menschen entschieden werden, sondern muss immer das Individuum im Blick haben um zu gelingen. Erste Schritte wagen hier die offenen Kleinklassenkonzepte der Waldorfschulen, die es ihren Schülern ermöglichen auch teile des Regelunterrichts wahrzunehmen, oder aus dem Unterricht befreit zu werden und anstelle der Mathestunde lieber in der Küche der Mensa zu helfen. Kochen ist übrigens eine sehr anschauliche Form des Matheunterrichts. Auch in anderen Schulen finden wir immer häufiger derartige Konzepte. Schulgründungsinitiativen schießen wie die Pilze aus dem Boden und viele davon sind erfolgreich. Auch Staatliche Schulen werden von Pädagogen und Eltern zunehmend neu gedacht. Ich wünsche mir, dass dieser Prozess sich weiter entwickelt, denn wir brauchen nicht weniger Schulen, sondern mehr gelingende Schulen und Bildungskonzepte jenseits der verstandortlichten Schule, damit ein Lernort für jedes Kind zu finden ist.
weiblich, 35 Jahre
Hallo Leute, hallo Ilja … nein, lang ist es her.
Mein Nickname ist Jogy, bin 57 Jahre, z. Z. auf Alg 2 und habe eine schizoide Persönlichkeitsausprägung (dt.: Eigenbrötler). Ich stehe also trotz Boomerhintergrund nicht im Fokus des Mainstreams. Bevor ich mich über das Thema „Inklusion/Exklusion“ ereifere, möchte ich mein Verständnis darüber darlegen, anhand der deutschen Sprachfamilie. Die deutschen Dialekte entstanden aufgrund einer (2.) Lautverschiebung vom germanischen zum deutschen Sprachgebrauch. Dieses fand nicht überall statt, nämlich nicht im Niederländischen, Niederdeutschen (Plattdüütsch) und im Friesischen (Nordseegermanisch). Aufgrund ihrer Wirtschaftsmacht behaupteten die Holländer ihre Eigenständigkeit, die Niederdeutschen wurden eingebürgert, die Friesen sträuben sich bis heute. Die Schweizer lebten „ab vom Schuss“ (sie sprechen übrigens das deutscheste Deutsch). Holländer und Schweizer betrieben also (von sich aus) Exklusion, die Norddeutschen wurden integriert (Teile der 2. Lautverschiebung setzten sich durch), die Friesen streben eine Inklusion als sprachliche Minderheit an, ähnlich den Sorben im Spreewald. Dies ist zugegebenermaßen eine sehr einfache Darstellung, und ich möchte in Zeiten vereinfachender Darstellungen niemandes Intellekt beleidigen. Das tun genügend andere, die mit sehr schlichten Parolen um sich schmeißen, um Leute zu fischen, die sich in dieser komplexen Welt überfordert fühlen oder es sind.
Soweit ich weiß, erfolgt Inklusion am Besten in einer Gruppe von maximal 10 Leuten (sagen Militärpsychlogen). Das habe ich bei der Armee selbst erlebt, sogar unser „Stinkstiefel“ gehörte zu „uns“. Die anderen waren „die Anderen“, obwohl wir alle die gleiche Uniform trugen. Diese Gruppengröße gab es schon in der römischen Legion und bei den alten Griechen.
In Hierarchien ist geregelt wer der „Boss“ ist (Ausbildung, Fähigkeiten, Vitamin B). In Teams übernimmt der die Leitung, der mit dem Problem am besten vertraut ist. Das Problem bei der Sache sind Menschen, die unbedingt „Chef“ sein wollen (wer möchte nicht ein wenig Aufmerksamkeit?).
Meine Rede handelt von Leuten, die keine herausragenden Eigenschaften haben, sondern ihre Position dadurch halten, indem sie andere kleinmachen. Als Beispiel fällt mir Oliver Pocher ein. Auf VIVA (Musikvideosender) interviewte er Michaela Schaffrath, damals noch Porno-Star „Gina Wild“. Während des Interviews merkte er, dass er kein „dummes Weibchen“, sondern eine examinierte
Krankenpflegefachkraft, Schwerpunkt: Neurologie (d.h. Arbeit mit z.T. Schwerstbehinderten) vor sich hatte, fing er an Witze über „die Spasties“ und ihre Betreuer zu machen, damit sein überlegenes Moderatorensternchen vermeintlich heller leuchtete.
Viele Menschen haben Angst vor dem Unbekannten, dem Unkontrollierbaren. Deswegen bilden sie scheinbar homogene Gruppen, für die sie eine vermeintliche Überlegenheit generieren,auch zu dem Preis einer teilweisen Selbstverleugnung (Millionen Fliegen können nicht irren).
Das auch jahrelanges Kennen und scheinbar moderne (tolerante) Weltsicht dies nicht verhindern, haben auf grausame Weise die Balkankriege der Neunziger bewiesen. Jeder möchte „wer“ sein und nicht „was“. Die christlich-protestantische Prädestination (Vorherbestimmung) besagt: Geht es mir wirtschaftlich-materiell gut, bin ich „wer“ und „Gott“ ist mir gewogen.
Erklärt vielleicht die heutigen Schuldenberge.
Jogy 12.07.20
Die Lügen der Wohlfahrtsverbände
Veröffentlicht am 3. August 2020 von Raul KrauthausenWer erst “Barrieren in den Köpfen” beseitigen will, betreibt die gleiche Augenwischerei wie Weiße, die nichts gegen ihren Rassismus tun wollen.
Ich kann diese Plakate nicht mehr sehen. Sie lächeln mich auf der Straße an, von Litfaßsäulen herab grüßen Gesichter glückliche Erwachsene und noch glücklichere Kinder. Aufklärung soll das sein. Fast alle Wohlfahrtsverbände in Deutschland argumentieren, man müsse sensibilisieren, für die Belange der Menschen mit Behinderung. Verständnis für sie wecken. Letztendlich wollen sie darüber aufklären, dass Menschen mit Behinderung auch Menschen sind. Für diese Binse investieren sie Millionen von Euro in Werbekampagnen, und dann sind Deutschlands Straßen voll mit lächelnden Gesichtern – eindimensional auf Papier und damit in Parallelgesellschaften wie den isolierten Werkstätten und Wohnheimen eingerahmt, während nicht wenige Gebäude in der dreidimensionalen Welt dieser Straßen kaum barrierefrei sind, was eines der Probleme ist, um die wir uns zuallererst kümmern sollten. Es ist zum Mäusemelken.
All diese Kampagnen und das Gerede über Inklusion verschieben ein wichtiges Problem auf den Sankt-Nimmerleinstag: elementare Rechte von Menschen mit Behinderung werden ignoriert.
Müssen wir etwa Männer dafür sensibilisieren, dass Frauen auch Menschen sind? Oder dass Nichtdeutsche auch Menschen sind? Hat sich ein einziger Nazi durch das Anschauen eines Plakats gedacht: „Stimmt, Ausländer sollte ich eigentlich nicht jagen…“?
Let’s meetWas einen Rassisten vielleicht bekehrt, ist die Begegnung. Das schafft eine Chance. Wenn also Wohlfahrtsverbände lamentieren, man müsse erst einmal “die Barrieren in den Köpfen” der Gesellschaft abbauen, dann irren sie. Erst einmal müssen die real existierenden Barrieren gebrochen werden. Es geht um das Barrieren-Brechen im Alltag. Schulen müssen barrierefrei gemacht werden, die Straßen und die Verkehrsmittel, Kinos, Restaurants und Bars – damit wir uns überhaupt begegnen können. Danach können wir uns um die Barrieren in den Köpfen kümmern, wenn es sie dann noch gibt. Wohlfahrtsverbände aber lamentieren über den zweiten Schritt, um den ersten nicht machen zu müssen. Sie irren absichtlich – und damit lügen sie. Denn so bleibt alles, wie es war. Und das bedeutet: Keine Überlegenen ohne Unterlegene.
Der Forschungsbereich Critical Whiteness beschäftigt sich mit dem Weißsein als Norm, welche Privilegien mit sich bringt. Die Mehrheit schafft dadurch strukturierte Ungleichgewichte und eine Überlegenheitsposition von Weißen, über die sie wenig nachdenken. Wer nicht zu den Weißen gehört, muss sich dann stets mit dem Rassismus auseinandersetzen, ob er will oder nicht. Denn der ist da. Letztlich werden People of Color in den Köpfen als fremd eingestuft. Damit schafft das Weißsein einen unsichtbaren Maßstab für das Leben in Deutschland. Und es werden haufenweise Klischees geschaffen, bewusste und unbewusste (Stichwort: „Stuttgarter Randale“), die gefährlicher sind als die offene Anfeindung eines „Ausländer raus“ brüllenden Nazis, weil man Journalisten oder Oberbürgermeistern eher glaubt.
Diese Normen des Weißseins lassen sich auch nicht erfolgreich ausblenden, denn Aussagen wie “Ich sehe keine Hautfarben” oder “Für mich sind alle Menschen gleich” verwischen die Diffamierungserfahrungen, die Menschen machen und münden in Ignoranz. Daher hören wir nun allerorten, dass Weiße hinhören sollen, sich zurücknehmen sollen, Begegnungen zulassen sollen. Ein Problem: Weiße leben in einer Gesellschaft, in der sie sich wohl fühlen können, denn sie sind stets repräsentiert, da drängt sich die Notwendigkeit einer Beschäftigung mit Rassismus nicht durch die Vordertür auf. Weist man sie dann auf rassistisches Verhalten hin, reagieren sie zuweilen pikiert bis ablehnend. Will man ja nicht hören. Übrigens sehen Weiße sich natürlich als Individuen, während People of Color von ihnen als Mitglieder einer Gruppe wahrgenommen werden. Linke und Liberale schließlich sollten nicht so tun, als könnten sie nicht rassistisch sein – das macht sie nur weniger offen und verschärft das Problem. Auf und zu einer Schublade
Was dieser Exkurs soll? Ich werde ihn nun in die Lebenserfahrungen übersetzen, die Menschen mit Behinderung machen.
Norm in Deutschland ist, dass man nicht behindert ist. Menschen ohne Behinderung schaffen ein strukturiertes Ungleichgewicht, in dem Menschen mit Behinderung als anders wahrgenommen werden. Menschen mit Behinderung müssen bangen und kämpfen, damit sie eine Schulbildung und eine Chance auf dem Arbeitsmarkt wie die „Anderen“ erhalten. Sie müssen sich jeden Tag mit Diskriminierung auseinandersetzen: Wenn sie zum Beispiel irgendwo nicht weiterkommen, wenn man sie bevormundet oder über sie hinweg sieht. Immerhin blicken Menschen mit Behinderung auf eine lange Geschichte der Aussonderung zurück. Sie wurden früher weggesperrt und in der Nazizeit gar massenhaft ermordet, und heute leben und arbeiten sie oft isoliert in Sondereinrichtungen.
Dieser unsichtbare Maßstab hat Folgen. Denn wenn eine Behinderung als eine Abweichung wahrgenommen wird, setzt sich das medizinische Modell von Behinderung durch: Dann ist Behinderung ein Mangel, eine Krankheit. Dies aber stimmt meist nicht mit den eigenen Realitäten der Menschen überein, die mit ihrer Behinderung leben und sie als Teil ihrer Identität kennen. Und auch wir haben unsere Journalist*innen und Oberbürgermeister*innen, die zu einer verfahrenen Situation beitragen: Werkstätten für behinderte Menschen genießen einen guten Ruf, obwohl sie in Wirklichkeit unterfordernde Sondereinrichtungen sind. Endlos sind die Tiraden in der Mehrheitsgesellschaft, die davon labert, wie „gut eingebunden“ man durch die Werkstatt in die Arbeitswelt sei. Es ist auch falsch, von einer „Farbblindheit“ zu sprechen und alles zu verwischen, weil ja jeder irgendwie eine Behinderung habe – denn so wird auf Diffamierungserfahrungen ein Deckel gestülpt, ein Diskurs unterbunden.
Vor allem Menschen, denen eine Behinderung fehlt, sind die, die über Menschen mit einer solchen reden. Sie beurteilen und legen fest. Daher gibt es nun den Appell, dass sie sich zurücknehmen sollten, zuhören sollten: Nichts über uns, ohne uns! Das geschieht nicht folgenlos. Wer einen Menschen ohne Behinderung auf sein Fehlverhalten hinweist, etwa auf Bevormundung oder ungefragtes Berühren, hört zuweilen pikiert: „Ich wollte doch nur helfen“ – und man ist in der Ecke des undankbaren, griesgrämigen Krüppels. Von Linken und Liberalen können wir auch manches Lied singen. Da gibt es die Helikopter-Eltern, die stets alles besser wissen, oder Leute in Berufen, die mit behinderten Menschen arbeiten und sie als Objekte sehen, für die sie entscheiden. Das trifft natürlich nicht auf alle zu, aber auf einen Teil. Und der bildet sich zu einer Struktur aus.
Um all diesen Mist abzubauen, brauchen wir Begegnung und Protest um die Teilhabe behinderter Menschen zu ermöglichen. Aber bitte klebt keine weiteren Plakate!
(Quelle: https://raul.de/leben-mit-behinderung/die-luegen-der-wohlfahrtsverbaende/)
Vielen Dank Raúl Krauthausen für diesen Artikel, den wir freundlicherweise auf unserer ZAK-Aktionsseite „Sprechen wir über Inklusion“ veröffentlichen dürfen.
